Das alte Haus
Ranieri ist am Leben. Lachend kämpfen sie sich fernab des ausgetretenen Wanderweges durch das dichte Geäst und können die nahe Lichtung bereits erahnen. Der Endorphinrausch verleiht Priska ungeahnte Kräfte. Geschmeidig wie ein Panther erklimmt sie die teils mannshohen Felsbrocken, die von Riesenhand auf dem weichen, von Fichtennadeln übersäten Waldboden versprengt worden zu sein scheinen. Ranieri ist ihr dicht auf den Fersen. Sie spürt seinen warmen Atem in ihrem Nacken. Priska befindet sich in jenem prickelnden Schwebezustand sehnsüchtiger und bangender Vorfreude, den sie so lange wie möglich auszukosten beabsichtigt. Sobald der Zauber der ersten Nacht vorüber wäre, würden flüchtige Berührungen nur mehr eine angenehme und geborgene Wärme erzeugen, sich treffende Fingerspitzen keine explosiven Funken mehr schlagen, heiß-kalte Wechselbäder bei verstohlenen Blicken ausbleiben. Ein uraltes Spiel, dessen Ausgang zwar vorgezeichnet ist, das aber in diesem Stadium noch vom Hauch des Ungewissen umweht wird. Ein rares Lebenselixier, das nicht verschwendet werden darf.
Ranieri steht nun neben ihr. Dicht an dicht verharren sie. Ergötzen sich schweigend an dem Panorama, welches sich ihnen bietet, nachdem auch die letzten Bäume den Blick frei gegeben haben auf die üppige, farbenfrohe Pracht der spätsommerlichen Blumenwiese. Vis-a-vis, auf der anderen Seite des Eisacktals, erhebt sich sanft und grün der Ritten. Dahinter lugen die schneebedeckten Gipfel der Sarntaler Alpen hervor. Die wilden Berge, wie Priska die Dolomiten seit ihrer Kindheit nennt, befinden sich in ihrem Rücken. Ebenso wie das alte Haus, welches sich am oberen Rand des idyllischen Wiesenhangs an eine Felswand kauert. Versteckt hinter einer Handvoll Fichten, wäre es ein Leichtes, dieses baufällige, unscheinbare Gebäude zu ignorieren. Dennoch spürt sie dessen unheimliche Präsenz und ein leiser Schauer schweift über sie hinweg. Nur kurz, dann umfangen sie wieder die warmen Strahlen der Vormittagssonne. Die Blüten locken die Honigbienen mit ihrem verführerischen Duft. Verwundert stellt Priska fest, dass sie das betörende Bouquet in seiner vollen Bandbreite wahrzunehmen in der Lage ist – nicht nur den Anflug eines süßen Aromas wie zumeist.
Ranieris trockene, warme Finger schließen sich um ihre. Hand in Hand wandern sie durch die Blumen und Gräser, dem Abhang entgegen. Von Weitem scheint es so, als würde das bunte Blütenmeer unvermittelt enden und an der Kante der dunkle Abgrund lauern. Tatsächlich spielen hier die eigenen Augen dem Beobachter einen Streich. Der Hang fällt eher allmählich ab. Die Gefahr darf jedoch nicht unterschätzt werden. Auch auf solch paradiesisch anmutenden Bergwiesen haben Menschen – vielleicht vom Glück beschwipst, aber wer weiß das schon – den Halt verloren und sind verunglückt. Ein leichter Wind streicht über die Lichtung. Kein Vergleich zu den Böen weiter oben. Inmitten von Heerscharen unsichtbarer Grillen, die inbrünstig und beinahe ohrenbetäubend um die Gunst der Weibchen zirpen, lassen sich Priska und Ranieri nieder. Der Boden hat ausreichend Sonne gespeichert, deren Wärme er nun großzügig an die beiden jungen Menschen weitergibt.
Eine Weile sitzen sie still da und genießen es, dem Trubel im Tal entflohen zu sein. Es ist menschenleer hier oben. Die meisten Wanderer folgen dem bekannten Weg hinauf zur Trostburg, die oberhalb des Örtchens Waidbruck erhaben auf einem weithin gut sichtbaren Felssporn thront und mit ihrer geheimnisvollen Schönheit die Besucher anzieht. Eine Burg wie aus dem Märchen. Mit einer beeindruckenden Geschichte. Es gibt ein paar Stellen auf dem gegenüberliegenden Ritten, von denen der Wiesenhang mit dem alten Haus gut zu erkennen ist. Schon manch einer hat versucht, dieses magisch anmutende Fleckchen aufzusuchen und dabei die Trostburg als Orientierungspunkt gewählt. Und ist trotz größter Bemühungen gescheitert. So offen sich dieses verwunschene Stückchen Erde aus gebührlicher Entfernung präsentiert, so verborgen scheint es, sobald man sich in unmittelbarer Nähe befindet. Priska und Ranieri haben es vor langer Zeit zufällig entdeckt. Auf einem ihrer endlosen Streifzüge durch die Wälder rund um die Mauern der Trostburg.
»Ich habe meinen Eltern jetzt erzählt, dass ich studieren will,« unterbricht Ranieri nun das Schweigen. Er nimmt ein Spitzwegerichblatt in den Mund und kaut nervös darauf herum. »Wie haben sie es aufgenommen?« Priska weiß, dass vor allem Ranieris Vater andere Pläne hat für seinen Sohn, der zugleich sein einziges Kind ist. Den Hof soll er übernehmen, welcher sich seit vielen Generationen in den Händen der Familie Moroder befindet. Ranieri schenkt ihr einen vielsagenden Blick, dessen Unmut nicht ihr, sondern seinen Eltern gilt. Wie immer, wenn sie in seine unverwechselbaren Augen sieht, muss sie unwillkürlich an den Karersee denken. Eine unendliche Palette berückender Blautöne, je nach Stimmung variierend von freundlich-hell bis bedrohlich-dunkel. Wenn schon ertrinken, dann in diesen tiefen Wassern. Priskas Herz macht einen Satz. Nichts wünscht sie sich sehnlicher, als Ranieris Gesicht in ihre Hände zu nehmen und die verbitterten Züge weich zu küssen. Doch der von ihr Angebetete scheint gerade wenig empfänglich für solcherlei Liebesbezeugungen. »Er sagt, dann muss ich das Geld selbst aufbringen. Und gleich nach Bozen ziehen soll ich, falls ich wirklich auf das Studium bestehe. Er hat keine Lust, mich weiter durchzufüttern, wenn ich die Familie im Stich lasse.« »Hm.« Priska hört seine Worte zwar, aber sie muss sich dazu zwingen, ihnen folgen zu können. Sie ist abgelenkt. Von Ranieris angezogenem Knie, welches das ihre berührt, von seinem dezent-herben Odeur, das den Duft der sie umgebenden Blumen bei Weitem übertrifft. Ein eigens auf mich abgestimmter Blütennektar, der mich dummes Insekt zugleich ins Paradies und ins Verderben zieht, denkt sie und seufzt kurz auf. Jetzt werd nur nicht melodramatisch, Priska, ermahnt sie sich im nächsten Augenblick selbst. Die Pheromone leisten wirklich ganze Arbeit. Sie versucht, ihre wild durcheinander galoppierenden Gefühle und Gedanken zu zügeln und wenigstens einen sinnvollen Satz zu diesem bisher sehr einseitigen Gespräch beizutragen. »Hast Du Dich erkundigt, ob vielleicht ein Stipendium in Frage kommt?« Sie bemüht sich um einen souveränen Eindruck, doch ihre Stimme zittert. Ranieri scheint es nicht bemerkt zu haben. Er hat sich wieder abgewandt. Sein Blick schweift ziellos in die Ferne. Priska studiert verstohlen sein schmales und dennoch markantes Profil. Viel hat er nicht mehr von einem Jugendlichen an sich, obwohl er nächsten Monat erst sein 20. Lebensjahr vollendet. Auf seiner Stirn zeigt sich die altbekannte steile Sorgenfalte. Die sinnlich geschwungenen Lippen sind zu einem dünnen Strich zusammengepresst. Allein der wilde, blonde Haarschopf, auf den die Sonne ständig wechselnde Muster malt, zeugt von dem unbeschwerten, lebenshungrigen Schelm hinter diesem ernsten Antlitz. Sein Mund formt eine Antwort. Doch Priska hört sie nicht mehr. Ranieri und die Wiese verschwimmen vor ihren Augen.
Im nächsten Moment findet sich Priska in der Stube eines heruntergekommenen Gebäudes wieder. Die blinden, schmutzigen Fensterscheiben lassen nur spärliches Licht in den Raum. Dort drüben steht ein wurmstichiger Schaukelstuhl. Ein verschlissenes Kissen liegt auf der Sitzfläche. In den Ecken türmen sich Berge von zerfledderten Büchern und Zeitschriften. Und auf dem alten Kohleherd steht vergessen ein schwerer schwarzer Topf aus Gusseisen. Hier wohnt niemand mehr. Alles, was nicht niet- und nagelfest und von auch nur geringem Wert ist, wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit geplündert. Priska ist äußerst unbehaglich zumute. Ein modriger Geruch liegt in der Luft. Sie muss Ranieri finden. Zögerlich macht sie einen Schritt Richtung Tür. Die morschen Dielen geben knarzend nach und Priska zuckt zusammen. Wie bei einem Tier, das Gefahr wittert, meldet sich nun auch bei ihr der Fluchtreflex. Es besteht kein Zweifel. Sie ist im alten Haus. Ihr Herz klopft hart und schnell gegen die Brust. Mit bis zum Zerreisen angespannten Nerven tappt sie vorwärts. In panikgeschwängerten Situationen wie dieser scheint für Priska die Zeit beinahe still zu stehen. Sekunden werden zu Ewigkeiten, Bewegungen erfolgen in Zeitlupe und jedes einzelne Bild, das sich auf ihre Netzhaut brennt, bleibt dort für immer. Irgendwann ist sie an der Tür angelangt und betritt den schummrigen Hausflur. Sie sehnt sich danach, dieses Haus auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Aber sie will um keinen Preis Ranieri im Stich lassen. Unschlüssig und zitternd verweilt sie an der Schwelle. Über ihr ertönen plötzlich Schritte. Die Decke knarrt und ächzt unter der Erschütterung, als würde sie im nächsten Moment durchbrechen. Priska möchte rufen, aber ihre Kehle fühlt sich an, als wäre sie mit einem dicken Strick umwickelt. Auch das Atmen fällt ihr schwer. »Priska?« Das ist Ranieris Stimme. Er klingt ein wenig dumpf und weiter entfernt, als er ist, aber Priska wird augenblicklich von einer Welle der Erleichterung überflutet. Sie eilt zum Treppenaufgang.
Dann verändert sich alles. Es scheint, als hätte jemand das Loch in der Sanduhr gewaltsam erweitert. Wo sich die Sekunden zuvor zäh hindurchquetschten, rieselt der Sand nun in einem irrsinnigen Tempo nach unten. Zwei schwarze Augen starren Priska unverwandt an. Das hagere Gesicht ist gezeichnet von Verlust, Bitterkeit und dem unterschwelligen Bedürfnis nach Vergeltung. Priska spürt förmlich, wie die Freude über Ranieris Lebenszeichen schlagartig ausgelöscht wird von einer bösartigen Kälte, die ihr bis unter die Haarwurzeln kriecht. Die dunklen Augen gehören einer Frau mittleren Alters, die oberhalb des Treppenabsatzes von einem vergilbten Schwarz-Weiß-Foto auf sie herabschaut. Diese Erkenntnis hilft Priskas aufgewühlter Seele jedoch nicht, denn über ihrem Kopf hört sie Ranieris schmerzerfüllte Schreie und im gleichen Moment hinter sich das Rascheln eines langen Rockes. Als sie die letzten Stufen der baufälligen Treppe erreicht hat, wirft sie im Laufen hastig einen Blick nach unten. Sie vermeint eine Bewegung wahrzunehmen. Eine Art Nachbild von einer schwarz gewandeten Gestalt, die gerade um die Ecke in die Stube entschwindet. Noch vor wenigen Minuten hatte Priska eben dort innegehalten. »Das ist wie in einem furchtbaren Alptraum,« denkt sie verzweifelt, während sie fast besinnungslos in die Richtung stolpert, aus welcher sie Ranieris Rufe vernommen hat. Die Kammer rechter Hand befindet sich genau über der Stube. Hier muss er sein. Rasch tritt sie ein, um der Angst zuvorzukommen, die sie in Kürze endgültig lähmen würde. Jemand schiebt sich bedächtig in ihr Sichtfeld. Doch es ist nicht Ranieri. Noch bevor ihre Augen an ihr Gehirn weitergeben, was sie da vor sich sieht, spürt sie es. Die Härchen auf ihren Unterarmen stellen sich auf und die Kälte in ihr wird zu Eis.
Sie ist groß. Priska registriert zuerst die reich verzierte Brosche, welche am Kragen der Spitzenbluse befestigt ist. Sie will es nicht und schaut dennoch nach oben. Zwei schwarze Augen fixieren sie lauernd. Der lange Rock raschelt, als sie auf Priska zugeht.
Schweißgebadet und panisch röchelnd fährt sie hoch. Ihre Finger sind in der Bettdecke verkrallt. Sie hat also tatsächlich geträumt. Krampfhaft versucht Priska, ihre Lungen so schnell wie möglich wieder mit Sauerstoff zu versorgen. Die Atemnot und das völlig aus dem Takt geratene Herz lassen ihre Brust fast bersten. Als sie wieder Luft bekommt, hangelt sie sofort nach dem Schalter ihrer Nachttischlampe. Die grässlichen Augen, die sie noch immer aus der Dunkelheit heraus zu verfolgen scheinen, verblassen im hellen Schein der beinahe grellen LED-Glühbirne. Priska spürt, wie ihr Schlafanzugoberteil klamm an ihrem Rücken und auf ihrer Brust klebt. Fröstelnd zieht sie sich die Bettdecke bis ans Kinn. In ihr toben widersprüchliche Gefühle. Die Angst vor der schwarzen Frau wird überlagert von der intensiven, alles verzehrenden Glut ihrer ersten Liebe. Sie flackert noch etwas nach und verebbt schließlich zu einem sanften Glimmen, während sich die letzten Schwaden der Traumnebel auflösen. Was bleibt, ist eine qualvolle Sehnsucht. Sie schluckt schwer. Es ist lange her, dass sie von Ranieri geträumt hat. Ein schmerzhafter Stich durchfährt ihr Herz, das noch immer nicht in seinen normalen Rhythmus zurückgefunden hat.
Auch die schwarz gekleidete, verhärmte Frau, welche sie tatsächlich nur von der gespenstischen Schwarz-Weiss-Aufnahme im alten Haus kennt, ist ihr schon viele Jahre nicht mehr in ihren Träumen begegnet. Jenes Foto hatte sich allerdings derart in ihr Hirn gefressen, dass sie seitdem keine Porträtaufnahmen aus dem 19. Jahrhundert betrachten kann, ohne in Angstzustände zu verfallen. Bereits als kleines Mädchen war ihr unheimlich zumute, wenn Personen auf den Gemälden der alten Meister sie mit ihren Augen verfolgten. Sie positionierte sich in jeden nur erdenklichen Winkel zu den Bildern und dennoch: Diese Gesichter starrten sie an, egal, wo sie stand. Ein bekanntes Phänomen, das sie noch immer verstört. Im Vergleich zu der Fotografie im alten Haus sind die Augen auf den Kunstwerken in den Pinakotheken jedoch leere, tote Glasmurmeln. Priska merkt, wie sich das Bild der schwarzen Frau von Minute zu Minute unauslöschbarer in ihrem Kopf manifestiert. Nein, diese, sie in ihren Grundfesten erschütternden Ängste würde sie nicht mehr mit sich spazieren tragen. Nie mehr.
Verzweifelt und zugleich verbissen versucht sie, an etwas anderes zu denken.
Sie wirft einen Blick auf ihren Wecker. Es ist zwei Uhr. Noch ausreichend Zeit, um eine halbe Schlaftablette einzunehmen, die ihr helfen würde, den morgigen Tag zu überleben, ohne gleichzeitig gegen den bleischweren Überhang ankämpfen zu müssen, den diese sogenannten Z-Drugs gerne hervorrufen. Priska schlägt die warme Decke zur Seite und stemmt sich aus dem Bett. Bevor sie sich auf den Weg nach unten zum Arzneimittelschrank macht, schleicht sie so leise wie möglich zum Elternschlafzimmer hinüber. Der Anblick des friedlich schnarchenden Luis und ihrer Tochter, die sich eng an des Vaters Rücken gekuschelt hat, normalisiert ihren Puls endlich.
Unten angekommen, teilt sie eine der kleinen, weißen Tabletten und spült sie mit einem großen Schluck Sprudel hinunter. Um den Rest des Glases zu leeren, braucht sie etwas länger. Wasser mit Gas, wie die Südtiroler sagen, kann sie nie auf Ex trinken. Beinahe versonnen betrachtet sie die zischenden Kohlensäurebläschen, wie sie an die Oberfläche treiben, sich vereinigen, wieder voneinander lösen und schließlich zerplatzen. »Alles wird gut,« beschwichtigt sie sich und ihre Gedanken, die sich ungeachtet ihrer Bemühungen nicht bändigen lassen.
Es fühlt sich an wie eine Bestätigung, als ihr in diesem Moment jemand sanft über den Kopf streicht. Nur ein Hauch von einer Berührung, aber sie ist echt. Priska dreht sich reflexartig um, obwohl sie weiß, dass es unnötig ist. Denn hinter ihr steht niemand. Die unsichtbare Geisterhand ist längst verschwunden.







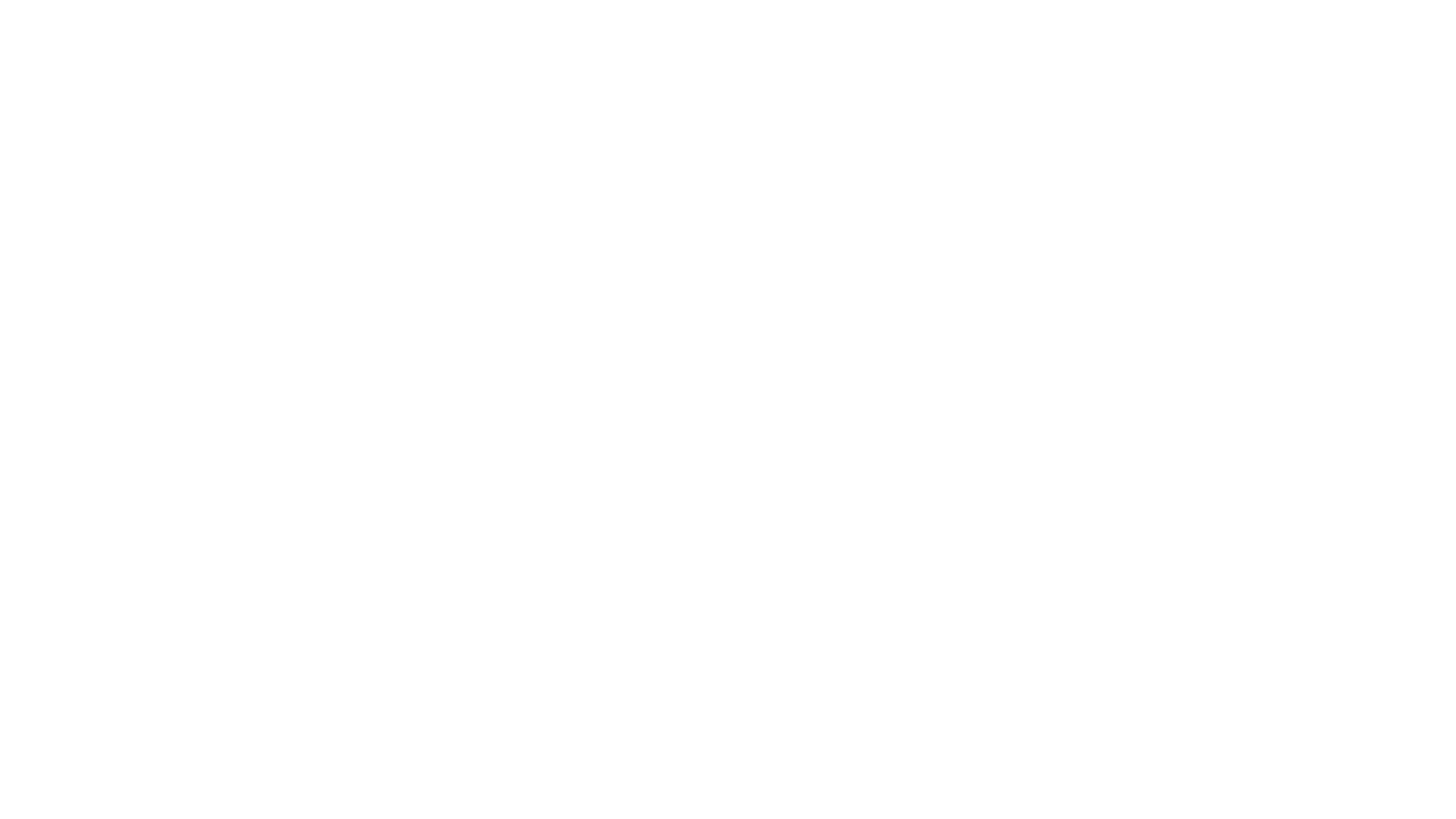
(Nicht lektorierte Rohfassung)
Wow! Ich sitze hier und will eigentlich schlafen gehen, bin aber gefesselt von der Erzählung. Man kann sich jede Szene so bildlich vorstellen und sie gefühlsmässig nachempfinden- irre! Wer weiss, ob ich heute Nacht schlafen kann?? Viele Grüsse!
😀 😀 😀 Muss mir mit den Smilies behelfen, weil du ja leider mein fettes Grinsen nicht sehen kannst. Danke für dein Lob! Das beflügelt mich total! Kann ich dich als Motivatorin engagieren? 🙂
Liebe Federfarbenfee,
meine Ahnung hat mich also nicht getrügt :D. Am Anfang, als es immer kitschiger wurde, fast ein wenig zu kitschig für meinen Geschmack, dachte ich schon, da müsse etwas faul sein ;-).
Mir gefällt der Kontrast zwischen den Stimmungen in diesem Kapitel sehr gut, der Schwenk aufs Gruselige, Düstere ist Dir super gelungen! Leider bin ich derzeit ein wenig gestresst und schaue daher seltener vorbei als geplant, aber Du siehst, ich komme immer wieder 😉
Liebe Grüße
Claudia
Liebe Claudia,
ja, zwar ist die Beziehung zu Ranieri ein zentraler Aspekt in der Geschichte. Doch deshalb soll letztere auf keinen Fall zur Schnulze mutieren. 😉 Diesbezüglich kann ich mich in meinem anderen Projekt, an dem ich parallel arbeite, austoben. 🙂 Wobei sich auch da der Kitsch hoffentlich in Grenzen hält und mit einer ordentlichen Portion Humor abgefedert wird.
Freut mich, dass dir das Kapitel im Großen und Ganzen gut gefällt! 🙂
Und bitte stress dich nicht! Ich leide selbst unter chronischem Zeitmangel und kann sehr gut nachvollziehen, wie es ist, wenn die Ruhe und Muse fehlt, auf anderen Blogs zu stöbern. Ich freue mich über deine Besuche, auch wenn du nur hin und wieder den Kopf hier reinstecken solltest! <3
Herzliche Grüße zurück von Mary